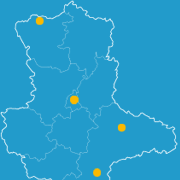„70.000 Dessauer können nicht Schuld sein.“ Theaterprojekt zum Fall Oury Jalloh reflektiert die Debatte um den Feuertod in einer Dessauer Polizeizelle
SchwarzWeiss ist nicht viel an der gleichnamigen theatralen Stadtbegehung, die am 10. Juni 2011 durch die Innenstadt ihre Uraufführung erlebt. Das Stück des Anhaltischen Theaters versucht sich an authentischen Orten an einer künstlerischen Aufarbeitung des Falls Oury Jallohs (mehr dazu hier…) und (hier…), jenes Asylbewerbes, der am 07. Januar 2005 qualvoll verbrannte. Ohne Zeigefinger aber durchaus mit Positionen, ohne Wertungen aber durchaus mit Meinungen und Haltungen, sind es gerade die reflexiven Grautöne der Aufführung, von denen nicht wenige Premieregäste berührt sind. Gleich im ersten Bild kommt dieser Anspruch überdeutlich zum Vorschein. Das Publikum wird gebeten, traditionelle afrikanische Kleidung überzustreifen. Nicht alle kommen dieser Aufforderung nach. Auf den Gehröcken, Blusen,Tüchern und Kopfbedeckungen findet sich neben Schlagwörter wie „Toleranz“, Menschenwürde und „Solidarität“, auch der Spruch: „Oury Jalloh – das war Mord“, stilecht unterlegt mit einem roten Feuerzeug. Diese Staffage polarisiert – und sie soll es wohl auch. Ob die Inszenierung es schafft, die Sprachlosigkeit abzubauen und Brücken des Dialoges zu schlagen, wird die Resonanz zeigen. Ein Beitrag zum Diskurs um ein demokratisches Miteinander in der Bürgergesellschaft, der selbstredend nie zu Ende sein kann, ist das Projekt allemal.

Das Stück beginnt im Dessauer Stadtpark. Nicht von ungefähr haben sich die TheatermacherInnen um Nina Gühlstorff, Dorothea Schroeder und deren Team diesen Ort ausgewählt. Just vor 11 Jahren auf den Tag genau, ermordeten rechte Schläger dort den Familienvater Alberto Adriano (mehr dazu hier…). Auf der provisorisch anmutenden Bühne sind die nächsten zehn Minuten zwei zentrale Akteure zu sehen, wenngleich als Puppen: Ein Afrikaner und ein Polizist in Uniform. Was nun zu hören ist, sind Positionen, Stereotype und Pauschalisierungen die all denen längst inflationär bekannt sind, die sich in den breiten Diskursfluss um den Fall Oury Jalloh begeben haben oder diesen gar aktiv mitgestalteten. Dennoch ist gerade dieser Mix aus semidokumentarischem Anspruch, bewusster Überhöhung und Persiflage der Realität irgendwie ein passendes Ticket, eine Eintrittskarte auch für die Theater-Passagiere, die die Debatten nicht im Detail verfolgt haben. Übrigens atmet das Stück hier - und auch in vielen anderen Szenen - ein gerütteltes Maß an Authentizität. Auch ohne Lupe und ausführlicher Internetrecherche, sind die den Figuren zu Grunde liegenden wirklichen AkteurInnen sofort eindeutig zu markieren. Hier zahlt sich aus, dass die Regisseurinnen im Vorfeld zahlreiche Tiefeninterviews mit der Polizei, der Staatsanwaltschaft, antirassistischen Gruppen, der afrikanischen Community und Beratungsstellen geführt haben.

Abak Safaei-Rad (r.) und Jan Kersjes eröffnen die theatrale Inszenierung im Dessauer Stadtpark
„Es ist mir nicht ganz leichtgefallen etwas zu sagen, solange der Prozess am Magdeburger Landgericht anhängig ist“, lässt Schauspielerin Abak Safaei-Rad ihre Polizeipuppe sagen. Und später folgt dann: „Wir leben in einem Rechtsstaat, hier hat niemand das Recht jemanden vom Hörensagen einfach so zu verdächtigen, dass macht hier das Gericht.“ Gerade diese Sequenz deutet augenscheinlich auf politische Meinungsäußerungen hin, die nicht nur einmal am Rande von Demonstrationen und Kundgebungen in dem Ausspruch „Oury Jalloh - das war Mord“ mündete. Die Erfahrungswelt von Flüchtlingen und MigrantInnen reflektiert dann Jan Kersjes, wenn er seine Puppe postulieren lässt: „Wir müssen seit Geburt mit dieser Hautfarbe leben, jeden Tag.“ Auch die Skepsis, die nach Meinung vieler vor allem an der bislang gescheiterten juristischen Aufarbeitung, die die Geschehnisse im Polizeigewahrsam eben nur sehr unzureichend aufklären konnte, begründet ist, darf nicht fehlen: „Der Mensch besteht zu 50% oder noch mehr aus Wasser, was soll denn da brennen?“

In der wirklichen Realität und auch in der Logik des theatralen Stadtrundganges, ist die nächste Station der Prozess. Bevor die Schauspieler und Gäste dort ankommen, skandiert eine Frau lauthals aus dem Fenster eines Plattenbaus der Gruppe entgegen: „Das haben wir nun schon lange genug gehört, nun ist es mal gut.“ Nicht nur, dass dieses inszenierte Blitzlicht aus dem Stadtgespräch alle Klischees bedient. Die Dame hat schließlich Lockenwickler im Haar und personifiziert bestens die Mecker- und Zuschauerdemokratie, die inzwischen allerorts beklagt wird. Solche oder so ähnliche Meinungsbilder, konnten am Rande von Kundgebungen und in Lesebriefen im Zusammenhang mit dem Fall Oury Jalloh tatsächlich immer wieder belegt werden. Wie deutungsmächtig solche Positionen wohl in der Stadt sind?

Zahlreiche Theaterbesucher im Stadtpark
Im improvisierten, spartanisch eingerichteten und durch das Publikum überfüllten Gerichtssaal tummeln sich nicht nur die Parteien, die für eine Hauptverhandlung zwingend erforderlich sind. Eine deutsche Aktivistin, dargestellt von Eva-Marianne Berger, beklagt die Schließung eines informellen Treffpunktes für die Community und beschwert sich schließlich, dass das Transparent mit der Aufschrift „Für ein respektvolles Miteinander“ niemand mehr öffentlich zeigen möchte: „Jetzt tragen wir das auch nicht mehr weil keiner mehr da ist, der es mitträgt.“ In ihrer Hilflosigkeit und wohl auch symbolisch, überreicht sie das Spruchbanner schließlich einer Afrikanerin. Wer auch nicht fehlt, ist die Frau aus der Ausländerbehörde (Abak Safaei-Rad). Im lupenreinen Bürokratendeutsch sagt sie einen Satz und betont im selben Atemzug, das ihr die Ausländer doch auch leid tun: „Sie sind zur Rückkehr zu bewegen oder es erfolgt die geordnete Rückkehr ins Herkunftsland.“
Dem Richter, der anfangs unter den Klängen eines bekannten französischen Chansons noch ein Feuerzeug aus der Robe fingert und damit beginnt, das „Oury Jalloh auch kein Waisenknabe war“, ruft „Dessau in den Zeugenstand.“ Später scheint ihm die Führung der Hauptverhandlung zu entgleiten. Zu wild geht es durcheinander, sind doch die Interessenlagen partikulativ. „Für mich ist es bis heute ein tragischer Unglücksfall, das habe ich ja schon gesagt“, spricht der Polizeibeamte, gespielt von Hans-Jürgen Müller-Hohensee. Er zeigt sich im Prozess aussagefest, prinzipientreu und visionär: „Das hat Dessau polarisiert, dass wieder herauszubekommen, ist die Aufgabe einer ganzen Generation.“ Und noch eins stört den Staatsdiener ungemein, nämlich die zynische Einschätzung auf der anderen Prozessseite: „Ein Afrikaner ist Schuld, ist Ursache dass Polizisten nun vor Gericht stehen.“ Das ist für den Beamten zu viel, er verlässt wutentbrannt den Saal. Die Frau von der Ausländerbehörde schließt sich an.

Der Richter und das Feuerzeug
Das vierte Bild spielt im Telecafe in der Friedrich-Naumann-Straße, in jenem Treffpunkt, in dem viele AfrikanerInnen der Stadt ihre Freizeit verbringen. An den Wänden hängen Pokale vom antirassistischen Fußballturnier „african kick“ (mehr dazu hier…), eine Urkunde zur Preisverleihung im Rahmen des Wettbewerbers „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ (mehr dazu hier…) und ein Plakat des Netzwerkes GELEBTE DEMOKRATIE mit dem Konterfei von Mouctar Bah (mehr dazu hier…) . Der hat sich immer wieder öffentlich für die Aufklärung im Fall Oury Jalloh eingesetzt und dafür u. a. die Carl-von-Ossietzky-Medaille erhalten. Im Cafe sitzt ein Asylbewerber (Jan Kersjes) und schildert im gebrochenen Deutsch, mal mit französischem, mal mit englischem Dialekt, die Lebenswirklichkeit von Flüchtlingen und spart dabei die Situationen in den Herkunftsländern nicht aus: „Afrika is hard. No Arbeitsamt, no Krankenversicherung!“ Mouctar Bah steht während der ganzen Szene hinter der Theke, ohne ein Wort zu sagen. Zuletzt wird die Debatte um den offenen Drogenhandel in der Stadt nicht ausgespart, wenn gleich mit einer regelrecht philosophisch-humoristisch aufgeladenen Erkenntnis: „Kokain ist a human right, the problem: the human.“

Jan Kersjes als Asylbewerber und Mouctar Bah (r.)
Gleich nebenan in „Media“-Kneipe spricht ein Europäer, gespielt von Matthieu Svetchine, seine Vorurteile an, die er beim Besuch der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika so mich sich herumgetragen hat, um die eigenen Komplexe gleich mit aufzubereiten: „In dem Stadium waren ja auch nur Schwarze drin, höchstens ein paar Weiße. Diese unbewusste Schuld allem gegenüber, was afrikanisch ist.“ Doch offenbar sei Fußball genau der Kitt, nachdem die Integration solange gesucht habe: „Er half mir, meine Angst vorm Schwarzen Mann zu überwinden.“ Der szenische Monolog wagt sogar ein Schlaglicht auf die Frage, warum fremdenfeindliche Einstellungen im Osten der Republik so signifikant höher sind, als anderswo in Deutschland. Eine Erklärblüte vom großen Ursachenstrauß gefällig? „In der DDR hat man die Völkerfreundschaft verordnet, im Sozialismus gibt es keinen Rassismus", so der Darsteller volle Überzeugungskraft. „Bei MTV sah ich die einzigen Schwarzen, die gut aussahen“, verteilt der Analyst im Döner-Imbiss zudem fleißig Seitenhieben auf das Afrikabild im Deutschland der 1990iger Jahre. Und ganz zum Schluss schafft er es noch, auf den Fall Oury Jalloh zurückzukommen. Auch Dessau habe seinen Schuldkomplex, denn es nun gelte endlich abzubauen. Zwar habe da „ein Arzt gelästert“, aber das sei doch nicht repräsentativ: „70.000 Dessauer können nicht Schuld sein.“

In der Friedrich-Naumann-Str. spielen gleich fünf Szenen
Die nächste Station ist das Comic-Kombinat. Wo einst bunte Heftchen über den Ladentisch gingen, ist nun die Polizeidienststelle eingerichtet. Beim Bierchen und Dart-Spiel machen sich zwei Beamte ihre eigenen Gedanken zum Fall. Über der Szene prangt ein großen Schild, dass wirklich nicht überlesen werden kann: „Diese Aussagen wurden nicht von der Dessauer Polizei getätigt.“ Für die Beamten im Stück steht unerschütterlich fest: „Die Art und Weise wir darüber berichtet wurde, dass ist der eigentliche Polizeiskandal“. Auch Ordnungshüter sind schließlich in Zivil auch Menschen: “Es ist kaum auszuhalten, dafür als Faschist und Mörder tituliert zu werden.“ Und überhaupt, die Polizeizelle ist das Herz des Staates und nur „die Loyalität der Polizei“ sorgt dafür, dass „dort niemand verschwindet“. All die Nachbrandversuche und der ganze Aufwand der betrieben wurde, das zerre schon ungemein an den Nerven: „Machen Sie doch einmal einen schreienden Schwarzafrikaner nach.“ Dann widmen sich die Polizisten wieder ihrem Bier und der treffsicheren Freizeitaktivität.

Das Team der TheatermacherInnen
In der vollbesetzten Turnhalle, gleich eine Hausnummer weiter, steht dann modernes Theater auf dem Spielplan. Störung, Konfrontation und Verunsicherung ist angesagt. Der Ort in Kombination mit dem minimalistischem Bühnenbild, sorgt für eine angespannte Stimmung. Der Kontrast zwischen seichtem Diskosound aus den 1980iger Jahren und dem schonungslosen Dialogen könnte größer nicht sein. „Weist Du, Du zerlegst die ganze Zeit Rinder“, wird auf einen Arbeiter im Dessauer Schlachthof angespielt. Schnell ist klar, es handelt sich um Alberto Adriano: „Nur die Neger stinken. Die Deutschen können schwitzen, die stinken da nicht. Also, im Schlachthof war es schlimm!“ Uns während sich der Schauspieler schwarz anmalt und später in der ganzen Szene waschzwangneurotisch versucht, sich den Zustand von der Haut zu spülen, erfährt der Theatergast warum der Afrikaner damals nach Dessau kam. Von einer Anwerbekampagne in seinem afrikanischen Dorf ist da die Rede. Dann ein Bruch, augenscheinlich spricht nun Volkes Stimme: „Und das der Adriano erschlagen wurde, schrecklich. Aber nun ist mal wieder gut.“ Und auf die sicherlich nur rhetorische Frage, ob Dessau mehr Ausländer braucht, skandieren die Darsteller im Chor: „Gott bewahre!“ Die Figur einer Flüchtlingsaktivistin, gespielt von Abak Safaei-Rad, hat da längst die dramaturgische Konfrontationsstufe gezündet. Sie wettert gegen die unhaltbaren Zustände in Asylbewerberheimen und fordert nicht zuletzt von den Flüchtlingen eine eigene Meinung – und wohl auch eine aktive politische Beteiligung - ein, abseits von kulturellen Klischees: „And stop the fucking Neger-Thrash!“

Der Alte Dessauer als Animateur

Vor dem Alten Theater erwartet die Besucher nach fast 3 Stunden das letzte Bild. Holztribünen sind aufgebaut und aus den Boxen schallt „Freude schöner Götterfunken“. Fürst Franz, hier natürlich mit Migrationshintergrund, skandiert im Stile eines Volksfestmoderators lauthals: „Hallo Dessau!“ Das Finale wird durch eine Tombola der etwas anderen Art gekrönt. Aus den Pässen und Ausweisen, die die Zuschauer zu Beginn als Pfand für die afrikanischen Trachten mit Aufdruck hinterlassen mussten, werden drei glückliche Gewinner gezogen. Einer davon: Der leitende Oberstaatsanwalt Folker Bittmann. An einen Zufall oder gar Losglück glaubt dabei augenzwinkernd kaum jemand. Warum, wird wenig später klar: „Sie werden sich jetzt fragen ob es sinnvoll war, Schwarzafrikanern und Drogendealern ihren Pass anzuvertrauen?“ Dessaus höchster Anklagevertreter nimmt es derweil mit einem Lächeln hin, zeigt Humor. Ob er seinen Pass wieder bekommen hat, ist indes nicht überliefert.
verantwortlich für den Artikel: 
|